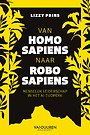1 Einleitung.- 2 Der politische Rahmen.- 2.1 Ein ereignisvolles Jahrhundert.- 3 Soziale und interkulturelle Kompetenz.- 3.1 Soziale Kompetenz.- 3.2 Interkulturelle Kompetenz.- 3.3 Verständnis für eine fremde Kultur.- 4 Der Kulturschock.- 4.1 Der Kulturschock liegt auf der Lauer.- 4.1.1 Die Einreise.- 4.1.2 Der Kulturschock.- 4.1.3 Die Anpassung.- 4.1.4 Die Heimkehr.- 4.2 Durch Vergleich von Kulturen Gemeinsamkeiten feststellen.- 4.3 Das sollten Sie beachten.- 5 Deutschlands Weltbild aus östlicher Sicht.- 5.1 Vorbemerkung.- 5.2 Die deutsche Gesellschaft.- 5.3 Die Gesellschaft in den Alten Bundesländern.- 5.3.1 Die östlichen, kritischen Stimmen.- 5.3.2 Das Bedürfnis nach Sicherheit oder die Angst vor Unsicherheit.- 5.4 Der Fall der Mauer - Betrachtungen zum Umbruch in Deutschland.- 5.5 Die Gesellschaftsordnung.- 5.5.1 Hierarchie.- 5.5.2 Die Familie.- 5.5.3 Die Sozialisation.- 5.5.4 Der Individualismus und das ,Ich’.- 5.5.5 Das Alter und alt sein.- 5.5.6 Die Emanzipation.- 5.5.7 Fremde Einflüsse - die „Amerikanisierung“ der Gesellschaft.- 5.6 Die Bedeutung von Zeit.- 5.7 Schule und Bildung, Ausbildung und Leistung.- 5.8 Wirtschaft, Verwaltung und Bürokratie.- 5.8.1 Wirtschaft und Verwaltung.- 5.8.2 Bürokratie in den Verwaltungen.- 5.9 Arbeit.- 5.9.1 Leistung.- 5.9.2 Dienstleistungen.- 5.9.3 Arbeitsstellen und Arbeitsplatz.- 5.9.4 Führungsstil.- 5.9.5 Produkte und Konsum.- 5.10 Freizeit.- 5.11 Privilegien, Statussymbole und Bescheidenheit.- 5.11.1 Privilegien.- 5.11.2 Statussymbole.- 5.11.3 Bescheidenheit.- 5.12 Recht und Gesetz.- 5.12.1 „Der Mensch und sein materieller und geistiger Besitz sind unantastbar“.- 5.12.2 Datenschutz.- 5.13 Der gesellschaftliche Umgang.- 5.13.1 Knapp und bündig.- 5.13.2 Das Leben ist hart und anstrengend.- 5.13.3 Jovialität und Distanziertheit.- 5.13.4 Kompromißbereitschaft.- 5.13.5 Meinungen, Kritik und Konflikte.- 5.14 Fremde im In- und Ausland.- 5.14.1 Westliche Vorurteile und der Umgang mit Menschen aus dem östlichen Mitteleuropa.- 5.14.2 Merkmale des Deutschlandbildes aus östlicher Sicht.- 6 Zusammenfassung.- 7 Das Weltbild des östlichen Mitteleuropa.- 7.1 Vorbemerkung.- 7.2 Polen, Tschechien und Ungarn.- 7.2.1 Wie sind sie?.- 7.2.2 Kulturschock und Identitätskrise nach der Wende.- 7.2.3 Unterwegs zu einer konsumorientierten Gesellschaft.- 7.2.4 Die Erfahrung des Umbruchs - Angst vor Enttäuschung.- 7.3 Die Gesellschaftsordnung.- 7.3.1 Sicherheitsbedürfnis und Sicherheitsängste.- 7.3.2 Die Ungarn sind “anders‘und ,alleine„.- 7.3.3 Hierarchie.- 7.3.4 Sozialisation im Sozialismus.- 7.3.5 Familie.- 7.3.6 Alter und alt sein.- 7.3.7 ,Wir’ und der Individualismus.- 7.3.8 Persönliches versus Sachliches.- 7.3.9 Die Emanzipation hat sich noch nicht herumgesprochen.- 7.3.10 Die Spuren des Sozialismus.- 7.4 Zeit..- 7.4.1 Zeit ist nicht immer Geld.- 7.4.2 Termine und Zeit.- 7.5 Schule und Ausbildung.- 7.5.1 Schule.- 7.5.2 Ausbildung.- 7.6 Wirtschaft und Verwaltung.- 7.6.1 Ein Spiegelbild der Familie.- 7.6.2 Bürokratie und Entbürokratisierung der Gesellschaft.- 7.6.3 Zur Medienstruktur - Telefonieren und Faxen.- 7.7 Arbeit, Leistung und Produktion.- 7.7.1 Der König, der früher Untertan war.- 7.7.2 Arbeitsstellen und Arbeitsplatz.- 7.7.3 Teamarbeit und gegenseitige Hilfe.- 7.7.4 Produkte.- 7.7.5 Die Sehnsucht nach einheimischen Produkten.- 7.8 Recht und Gesetz.- 7.8.1 Recht, Gesetz und die Gewohnheit, in Unsicherheit zu leben.- 7.8.2 Der Umgang mit dem Datenschutz.- 7.8.3 Kriminalität erlangte die Freiheit.- 7.9 Privilegien, Statussymbole und ,materielle’ Bescheidenheit.- 7.9.1 Privilegien.- 7.9.2 Statussymbole.- 7.9.3 ,Materielle’ Bescheidenheit.- 7.9.4 ,Geistige’ Bescheidenheit statt Souveränität.- 7.9.5 Freizeit meint nicht immer freie Zeit.- 7.10 Der Blick auf das Ausland.- 7.10.1 Assoziationen im östlichen Mitteleuropa.- 7.10.2 Volksgruppen.- 7.10.3 Fremde.- 7.10.4 Das Bild von Deutschland im östlichen Mitteleuropa -bekannte Fremde.- 7.11 Der Umgang miteinander.- 7.11.1 Kritik und Meinungen.- 7.11.2 Konflikte, Konfliktaustragung und Kompromißbereitschaft.- 7.12 Das sollten Sie beachten.- 8 Umgangsformen im östlichen Mitteleuropa.- 8.1 Die Begegnung.- 8.1.1 Begrüßung und Anredeformen.- 8.1.2 Begrüßung und Anredeformen in Polen.- 8.1.3 Begrüßung und Anredeformen in Tschechien.- 8.1.4 Begrüßung und Anredeformen auf Ungarisch - mit kleinen Unterschieden.- 8.2 Der Gast.- 8.2.1 Einladung in die Wohnung.- 8.2.2 Der König ohne Schuhe.- 8.3 Geschäftliche Einladungen.- 8.3.1 Geschäftsessen.- 8.3.2 Essen, Trinken und Geschäfte.- 8.3.3 Kleider machen Leute.- 8.4 Geschenke.- 8.4.1 Geschenke bei Privatbesuchen.- 8.4.2 Geschenke sind die beste Werbung.- 8.5 Das sollten Sie beachten.- 9 Sprache als Ausdrucksmittel der Kultur.- 9.1 Sprache ist verräterisch.- 9.2 Die slawischen und finnougrischen Sprachen.- 9.2.1 Polnisch und Tschechisch - eine slawische Sprachfamilie.- 9.2.2 Die russische Sprache.- 9.2.3 Das Ungarische, eine finnougrische Sprache.- 9.2.4 Wenn Sie beschließen, Polnisch, Tschechisch oder Ungarisch zu lernen.- 9.3 Die Verständigung in deutscher Sprache.- 9.3.1 Die Bereicherung der östlichen Sprachen durch die deutsche Sprache.- 9.3.2 Das ,verlorene’ deutsche Verb.- 9.3.3 Die , Kettenwörter’ im Deutschen und die Nöte des Dolmetschers.- 9.3.4 Sagen Sie das, was Sie tatsächlich sagen möchten?.- 9.3.5 Umgangssprache, Dialekte und Anglizismen.- 9.3.6 Einheimische Namen - ein wenig Mühe investieren.- 9.3.7 Das sollten Sie unterlassen.- 9.3.8 Fachbegriffe - der Multiplikator als Zuchttier.- 9.3.9 Witze und Vergleiche.- 9.3.10 Sprechen Sie dieselbe Sprache?.- 9.4 Das sollten Sie beachten.- 10 Ausdrucksformen im östlichen Mitteleuropa.- 10.1 Eine Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart.- 10.1.1 Vorsondieren statt direkter Fragen.- 10.1.2 Ja oder Nein?.- 10.1.3 Humor.- 10.1.4 Versteckspiele hinter dem ,Wir’.- 10.1.5 Notlügen im Privatbereich.- 10.1.6 Notlügen im Geschäftsleben.- 10.1.7 Ein Beispiel nonverbaler Kommunikation.- 10.2 Siezen oder duzen?.- 10.2.1 Polen und Tschechien.- 10.2.2 Die Unterschiede in Ungarn.- 10.2.3 Das kumpelhafte Du unter Männern.- 10.3 Das sollten Sie beachten.- 11 Zwei unterschiedliche Weltbilder.- 12 Die Entsendung des Managers.- 12.1 Die ,Mutterrolle’ von Firmen und Institutionen.- 12.2 Mehrjährige Auslandsaufenthalte.- 12.3 Der Auslandseinsatz - die Vorbereitung in Deutschland.- 12.3.1 Die Auswahl - Wer soll fahren, wer nicht?.- 12.3.2 Die Aufgabe von Mutterunternehmen und -institution.- 12.3.3 Familienangehörige, und was nun?.- 12.3.4 Interkulturelle Seminare.- 12.4 Die Einarbeitung des Nachfolgers.- 12.4.1 „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!“.- 12.4.2 Die Anpassung des Mitarbeiters vor Ort.- 12.4.3 Die Rückkehr zum Mutterunternehmen.- 12.5 Auslandsreisen von Führungskräften.- 12.5.1 Nur ein paar Tage.- 13 Das Unternehmen vor Ort.- 13.1 Ansichten einheimischer Mitarbeiter.- 13.2 Ausländische Consultingfirmen - Erfahrungen der Ostmitteleuropäer.- 13.3 Einheimische Bewerber.- 13.3.1 Die Einstellung eines einheimischen Mitarbeiters.- 13.3.2 Die Auswahl eines einheimischen Mitarbeiters.- 13.3.3 Das Bewerbungsgespräch mit einem einheimischen Mitarbeiter.- 13.4 Strukturen im Unternehmen vor Ort.- 13.4.1 Die Pyramide.- 13.4.2 Die Unternehmenskultur.- 13.4.3 Die Unternehmenskultur als Visitenkarte.- 13.4.4 Die Identifizierung mit dem Unternehmen.- 13.4.5 Die Unternehmensstruktur als organische Einheit.- 13.5 Der Vorgesetzte.- 13.6 Die Macht der Sekretärin.- 13.7 Der Umgang mit Mitarbeitern aus dem östlichen Mitteleuropa.- 13.7.1 Die Kommunikation im einheimischen Unternehmen.- 13.7.2 Konflikte und Konfliktlösung.- 13.8 Der Kunde, der kein „Untertan“ mehr ist.- 13.8.1 Die Kundenorientierung des einheimischen Mitarbeiters.- 13.8.2 Die Kunden.- 13.9 Frauen als Geschäftspartnerinnen.- 13.10 Das sollten Sie beachten.- 14 Geschäfte im östlichen Mitteleuropa.- 14.1 Was schätzen die einheimischen Arbeitnehmer an deutschen Kollegen?.- 14.2 Perspektiven und Verhaltensweisen westlicher Manager.- 14.2.1 Die typischen Fehler.- 14.2.1 Die Win-Win-Strategie.- 14.2.2 Die Win-Lost-Strategie.- 15 Verhandlungen mit ausländischen Partnern.- 15.1 Vorbereitungen.- 15.1.1 Verhaltensweisen.- 15.1.2 Verhandlungsziele und Verhandlungsspielraum.- 15.1.3 Die Präsentation Ihres Geschäftsvorhabens.- 15.1.4 Der Wert persönlicher Beziehungen.- 15.1.5 Die Unkenntnis des ausländischen Partners.- 15.1.6 Die Wahrnehmung.- 15.2 Die Dauer von Verhandlungen.- 15.3 Selbst- und Fremdbestimmung.- 15.3.1 Lassen Sie Ihren Partner selbst entscheiden!.- 15.3.2 Die Überforderung des Partners.- 15.4 Schwierigkeiten und Probleme bei Verhandlungen.- 15.4.1 Probleme mit Zielvorgaben.- 15.4.2 Was für Bedürfnisse hat Ihr Partner?.- 15.5 Verhandlungssprache und Verhandlungsort.- 15.5.1 Die Auswahl der Sprache.- 15.5.2 Der Verhandlungsort.- 15.5.3 Wo sitzt der Hauptverhandlungspartner?.- 15.5.4 Gute Manieren sind gefragt.- 15.6 Die Verhandlungen und das Rahmenprogramm.- 15.6.1 Das Kulturprogramm.- 15.7 Das sollten Sie beachten.- 16 Verhandlungsstrategien.- 16.1 Machtfunktionen.- 16.2 Die Persönlichkeit der Verhandlungspartner.- 16.2.1 Bewußte und unbewußte Verhaltensweisen.- 16.2.2 Der Verhandlungspartner.- 16.3 Verhandlungsstrategien und Verhaltensweisen.- 16.3.1 Unsachlichkeit - die Vermischung der Ebenen.- 16.3.2 Vorwände.- 16.3.3 Der Verhandlungsstil der Entrüstung - eine Strategie.- 16.3.4 Lügen.- 16.3.5 Suggestive Fragen.- 16.3.6 Kompromisse und Zugeständnisse.- 16.3.7 Gegenseitige Hilfe.- 16.4 Die eigene Persönlichkeit.- 16.5 Das sollten Sie beachten.- 16.6 Zusammenfassung.- 17 Die Weiterbildung.- 17.1 Die Weiterbildung in Polen, Tschechien und Ungarn nach der Wende.- 17.1.1 Die erste Phase.- 17.1.2 Die zweite Phase.- 17.1.3 Die dritte Phase.- 17.1.4 Die vierte Phase.- 17.2 Das Managementtraining.- 17.2.1 Die Weiterbildung der einheimischen Mitarbeiter im östlichen Mitteleuropa.- 17.2.2 Wer sollte weitergebildet werden?.- 17.2.3 Wer sollte die Weiterbildung durchführen?.- 17.3 Das sollten Sie beachten.- 18 Es gibt nicht nur eine Wahrheit.- 18.1 Die Globalisierung als interkulturelle Herausforderung.- 18.2 Deutschland versus östliches Mitteleuropa.- 18.2.1 Deutschland.- 18.2.2 Das östliche Mitteleuropa.- 18.3 Die Bedeutung gegenseitigen Respekts.- 18.4 Know-how und was noch wichtig ist.- 18.5 Rezepte für kulturgerechtes Management.- 18.6 Das Paradies existiert nirgendwo auf dieser Welt.- Geschichtliche Chronik im Überblick.- Die wichtigsten Institutionen.- Literaturhinweise.